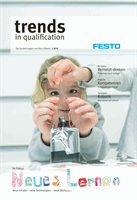„Ich denke, wenn
autistische Menschen
an Robotern lernen, sind
sie letztlich auch auf den
Umgang mit Robotern
begrenzt.“
Dr. Christine Preißmann,
Ärztin und Fachautorin mit dem Spezialgebiet Autismus
Bild: Preißmann
Tipp
Grundlagen der Robotik
Robotern eröffnen sich besonders im
Hinblick auf Industrie 4.0 viele inter-
essante Aufgabengebiete – jetzt ein-
steigen in das spannende Thema. Fes-
to Training and Consulting bietet das
Seminar „Grundlagen der Robotik“.
Die Teilnehmer lernen verschiedene
Industrieroboter und ihre Teilsysteme
kennen. Sie erfahren mehr über ihre
Eigenschaften, die Einsatzmöglichkei-
ten, Programmiermethoden und das
wichtige Thema Sicherheit. Dazu wer-
den viele praktische Übungen mit ech-
ten Industrierobotern durchgeführt.
www.festo-tac.atIm Suchfeld bitte die Webinfo-
Nummer 578435 eingeben
ganz großen Umfang“, erklärt Prof. Schul-
ler. „Dazu gehören die autistische Sprache
sowie die Bildverarbeitung für Bewegungs-
muster und Gestik. Wir liefern Verdachts-
momente und die Erkennungssoftware
überwacht Mimik, Gestik und Sprechver-
halten wie Grundfrequenz und Variabilität
der Stimme. So lassen sich Emotionen er-
kennen“, erläutert Schuller.
Skepsis an androider Kompetenz
Dass die androide Kompetenz den Kin-
dern in diesem Projekt nachhaltig helfen
wird, das bezweifelt die deutsche Ärztin
Dr. Christine Preißmann. Sie ist Fachauto-
rin mit Spezialgebiet Autismus und selbst
vom Asperger-Syndrom betroffen: „Der
Einsatz von Künstlicher Intelligenz ist auf
vielen Ebenen sinnvoll, aber ob es eine
Bereicherung für die emotionale Entwick-
lung sein kann, ist derzeit fraglich. Jeder
autistische Mensch ist ein Individuum.
Daher benötigen Autisten gezielte Betreu-
ung. Ich zweifle, dass Roboter diese Indi-
vidualität leisten können. Ich denke, wenn
autistische Menschen an Robotern lernen,
sind sie letztlich auch auf den Umgang
mit Robotern begrenzt.“
Datenflut wird wieder Roboterwissen
Die Auswertung der Informationen, die
man in den dreieinhalb Projektjahren von
„DE-ENIGMA“ sammeln möchte, ver-
spricht auf alle Fälle einen datentechni-
schen Quantensprung – nicht nur für die
Autismusforschung, sondern für die wei-
tere Wissenschaftsgemeinde. Noch nie
war es möglich, exakte Informationen zu
Verhalten, Mimik, Intonation, Lautstärke
und Bewegungsabläufen so komprimiert
und zielgruppengenau in großer Menge
zu sammeln.
Uncanny Valley Phänomen
Während viele Menschen weltweit von den
großen und kleinen androiden Helfern be-
geistert sind und die Wirtschaft im Bereich
der Robotertechnik astronomische Ver-
kaufszahlen prognostiziert, könnte es aller-
dings auch immer mehr zu einem Bruch der
kommerziellen Akzeptanzkurve auf dem
Weg zum perfekten Maschinenmenschen
kommen. Die Rede ist vom Uncanny Valley
Phänomen („unheimliches Tal“), das eine
psychologische Akzeptanzlücke markiert,
sobald eine Figur ein gewisses Niveau an
Anthropomorphismus erreicht: Was auch
immer hohe Menschenähnlichkeit besitzt,
aber sich nicht „perfekt“ wie ein Mensch
verhält, kann leicht suspekt wirken.
Die technologische Singularität
Trotzdem scheint am Ende des Weges die
technologische Singularität zu warten –
der Moment, in dem Mensch und Maschi-
ne in ihrer Intelligenz gleichwertig werden
und Maschinen sich selbst verbessern
und entwickeln. Ganz so einfach ist das
glücklicherweise nicht. Denn menschliche
Gefühlswelten bleiben Robotern vorerst
verwehrt. Für eine Annäherung müsste
die Informationsverarbeitung wie beim
Menschen zumindest mit der Physiologie
gekoppelt sein und das ist nicht nur eine
Frage der Sensorik. Es ist also nicht zu er-
warten, dass in naher Zukunft Maschinen
den Menschen an echtem Intellekt über-
trumpfen, auch wenn Siri das im Sinne
von Descartes schon heute glaubt: Auf
die Frage „Was hältst du von Künstlicher
Intelligenz?“, antwortet Siri: „Ich denke,
also bin ich.“
2.2016
trends in qualification
Synergien
32
–
33