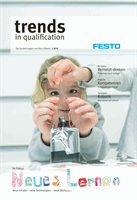„Durch Digitalisierung und die
Vernetzung ändert sich alles, auch
unsere berufliche Identität.“
PD Dr. Andreas Boes,
Vorstand am Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung München (ISF)
Bilder: Fotolia, HPI, ISF, Festo
rung und mit ihr auch, wie wir ticken.
„Früher funktionierte das noch fast aus-
schließlich mit repressiven Mitteln“, be-
schreibt der Professor die Entwicklung in
groben Zügen. „In der Schule wurde se-
lektiert und bestraft. Die Schüler erlebten
sich als Konkurrenten.“ Das Schulsystem
des Kapitalismus arbeite zunehmend
auch mit Belohnungen. Die Schüler blie-
ben jedoch Konkurrenten, seien nun aber
auch leichter verführbar. Der große passi-
ve Anteil dieser postindustriellen Schüler-
generation zeige sich angepasst und will-
fährig, fühle sich vermeintlich frei und
kümmere sich vor allem um sich selbst.
Gemeinsam erfolgreich
„Durch Schule und Ausbildung sind wir in
erster Linie als kompetitive Einzelwesen
unterwegs“, bestätigt auch Prof. Wein-
berg aus der Bedarfsperspektive der Wirt-
schaft. „Die Industrielandschaft braucht
aber immer mehr Persönlichkeiten, die
über die eigenen Fachgrenzen hinweg
denken und handeln können und denen
die Kollaboration wichtiger ist als der ein-
zelne Erfolg.“ Gemeinschaftssinn als
Grundlage für unsere Denk- und Hand-
lungsansätze? Klingt naturgemäß auf je-
den Fall sozial, Experten erkennen darin
aber vor allem eine klare, sachliche Di-
mension. „Gemeinsam erarbeitete Lösun-
gen sind immer richtiger, nutzbringender
und vollständiger, als jene, die ein Einzel-
ner sich erdenken kann“, erklärt Hüther.
„Die Gesellschaftsform, die das 21. Jahr-
hundert braucht, sind co-kreative Ge-
meinschaften – keine Konkurrenz- oder
zweckgebundenen Kooperationsgesell-
schaften. Gemeinsam kann man einfach
mehr Denken und die so gewonnenen
Ideen auch effektiver umsetzen.“ Neue
Lernziele allein reichen vermutlich nicht,
um den Einzelkämpfer-Modus abzulegen.
Hüther: „Die Bildungsverantwortlichen
müssen sich fragen, wie sie Co-Kreativität
fördern statt Konkurrenzdenken. Wie sie
Menschen darauf vorbereiten, dass sie
gemeinsam etwas gestalten und umset-
zen können“, erklärt der Mitinitiator der
Initiative Schule im Aufbruch und Gründer
der Akademie für Potenzialentfaltung mit
Standorten in Göttingen, Wien und Zürich.
Nicht nur das Gehirn lernt
Unsere zunehmend vernetzte Welt erfor-
dert also womöglich eine Art kollektive
Denkweise mit Blick über den Tellerrand,
was unsere biologische Grundausstattung
durchaus hergibt, wie Hirnforscher Hüther
weiß. Lediglich unser Bildungssystem sit-
ze auf unseren Anlagen wie ein Pfropf:
„Wir müssen den ganzen Lernbegriff
grundsätzlich hinterfragen. In der Schule
haben wir bislang immer nur kognitives
Lernen geschult. Lernen ist aber ein Merk-
mal des Lebens und mit Ebenen wie dem
sozialen, emotionalen und körperlichen
Lernen weitaus komplexer und vielschich-
tiger.“ Es sei eben nicht nur das Gehirn,
das lernt, sondern der ganze Mensch.
„Analytisches Denken etwa geht nicht nur
Umdenken gefragt:
Teamwork
statt Konkurrenz – Experten sehen
im kollaborativen Handeln großes
Potenzial für die Zukunft. Die
Grundsteine dafür werden schon
in der Ausbildung gelegt.